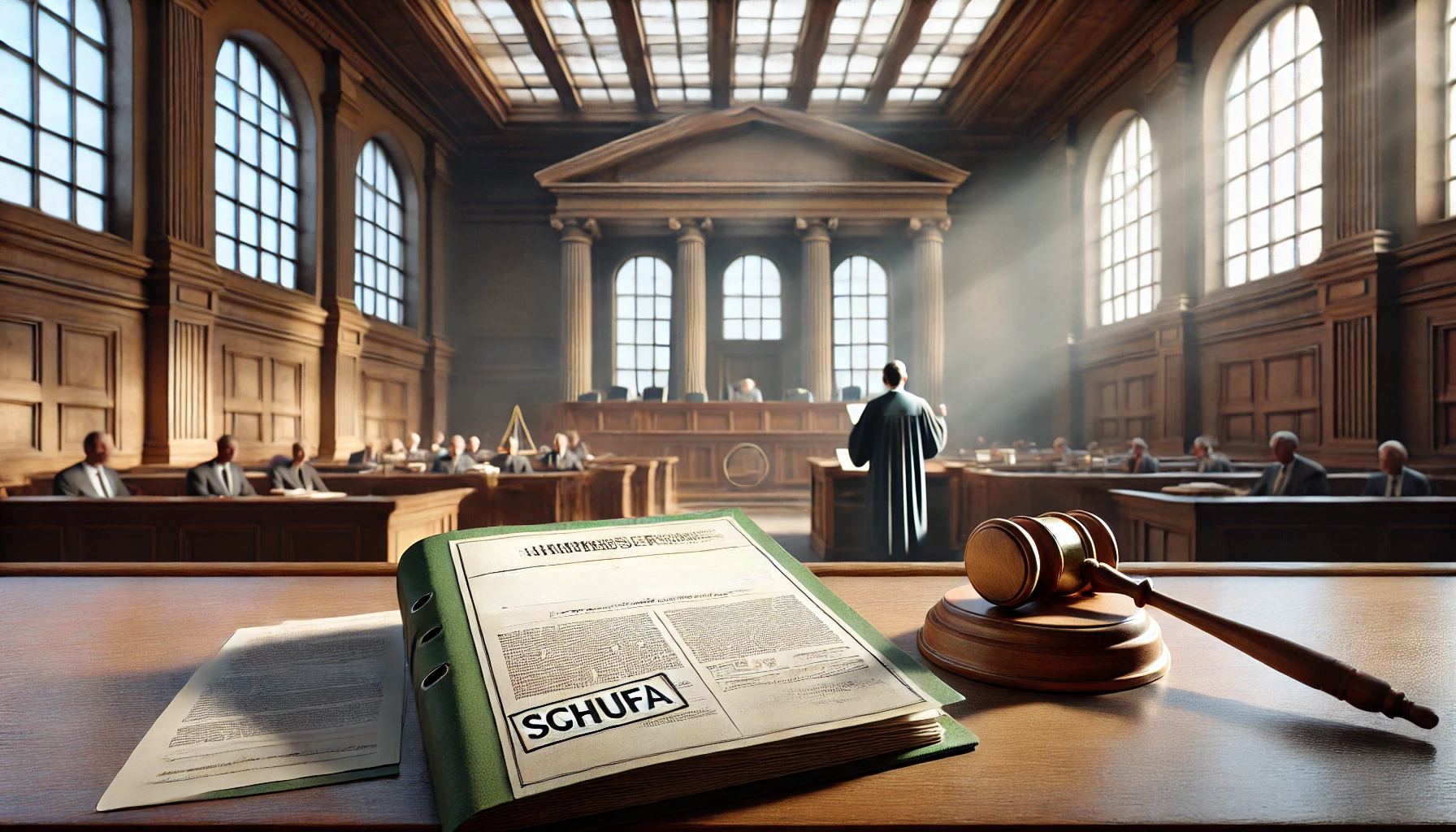Die unrechtmäßige Weitergabe personenbezogener Daten kann schwerwiegende Folgen für Betroffene haben, aus denen auch immaterielle Schadensersatzansprüche entstehen können. Ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 28.01.2025 (VI ZR 183/22) zeigt, dass Unternehmen sorgsam prüfen müssen, ob eine Datenübermittlung an die Schufa zulässig ist. In dem Fall wurde eine Verbraucherin aufgrund eines umstrittenen Mobilfunkvertrags zu Unrecht als zahlungsunfähig gemeldet. Der BGH sprach der Kundin einen Anspruch auf immateriellen Schadensersatz in Höhe von 500 Euro wegen rechtswidriger Schufa-Meldung zu.
Schufa-Meldung durch den Mobilfunkanbieter
Eine Kundin hatte einen bestehenden Mobilfunkvertrag um weitere 24 Monate verlängert, widerrief diesen jedoch kurz darauf. Der Telefonanbieter erkannte den Widerruf jedoch nicht an und stellte weiterhin Rechnungen aus. Die Kundin verweigerte die Zahlung. Trotz der Uneinigkeit über das Bestehen der Forderungen meldete der Anbieter nach einem dreiviertel Jahr den vermeintlich offenen Posten in Höhe von 542 Euro an die Schufa. Parallel hierzu leitete er gerichtliche Schritte ein.
Eine solche Meldung kann gravierende Konsequenzen haben: Sie beeinflusst die Kreditwürdigkeit und kann zu Nachteilen bei Finanzierungen oder Mietverhältnissen führen. Im vorliegenden Fall habe der Eintrag zur Folge gehabt, dass eine Kreditvergabe der Hausbank der Kundin verzögert wurde. Zwar veranlasste der Anbieter nach neun Monaten eine Löschung des Schufa-Eintrags, doch vollständig erfolgte dies erst mit erheblicher Verzögerung frühestens etwa zwei Jahre danach.
Klage auf Ersatz des immateriellen Schadens
Die Kundin klagte daraufhin auf immateriellen Schadensersatz in Höhe von 6.000 Euro nach Art. 82 Abs. 1 DSGVO. Das Landgericht Koblenz wies zunächst die Klage ab und verurteilte die Kundin sogar zur Zahlung der Mobilfunkrechnungen. Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz erkannte hingegen einen Anspruch auf Zahlung eines immateriellen Schadensersatzes in Höhe von 500 Euro an. Diese Höhe sei „angemessen und ausreichend“ insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Schufa-Eintrag eine stigmatisierende Wirkung habe. Die Kundin verlangte weiterhin den vollen Schadensersatz und ging in Revision
Entscheidung des BGH
Nachdem die Vorinstanzen unterschiedlich urteilten, hat sich nun der BGH in einem Urteil zu großen Teilen dem OLG angeschlossen. Er korrigierte jedoch die Begründung. Laut dem VI. Zivilsenat darf ein immaterieller Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO nicht der Abschreckung oder Bestrafung dienen, sondern allein einen Ausgleich für den erlittenen Kontrollverlust über personenbezogene Daten schaffen. Dabei berief sich der BGH auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wonach weder die Schwere des Datenschutzverstoßes noch ein Verschulden des Unternehmens für den Schadensersatzanspruch maßgeblich sind. Das OLG habe zwar unzulässigerweise auch abschreckende Aspekte in seine Bewertung einbezogen, dennoch sei ein Schadensersatz in Höhe von 500 Euro angesichts der Dauer des unzulässigen Schufa-Eintrags sowie der Zahl der Personen, die darauf Zugriff hatten, angemessen.
Fazit
Der BGH hat einige Klarstellungen zum immateriellen Schadensersatz wegen rechtswidriger Schufa-Meldung getroffen. Das Urteil setzt zunächst klare Grenzen für die Meldung offener Forderungen an Auskunfteien. Unternehmen müssen sorgfältig prüfen, ob eine Forderung unstreitig und durchsetzbar ist, bevor sie eine negative Schufa-Meldung veranlassen. Streitig gestellte oder noch nicht titulierte Forderungen dürfen nicht ohne weiteres gemeldet werden.
Darüber hinaus gibt die Entscheidung einen weiteren Anhaltspunkt darüber, in welcher Höhe bei solchen Falschmeldungen immaterielle Schadensersatzansprüche für Betroffene entstehen könne. Gerichte dürfen bei der Bemessung keine abschreckenden oder strafenden Zwecke berücksichtigen. Unternehmen sollte zu dem Bewusst sein, dass in solchen Fällen neben immateriellen Schäden auch schnell hohe materielle Schäden entstehen können.