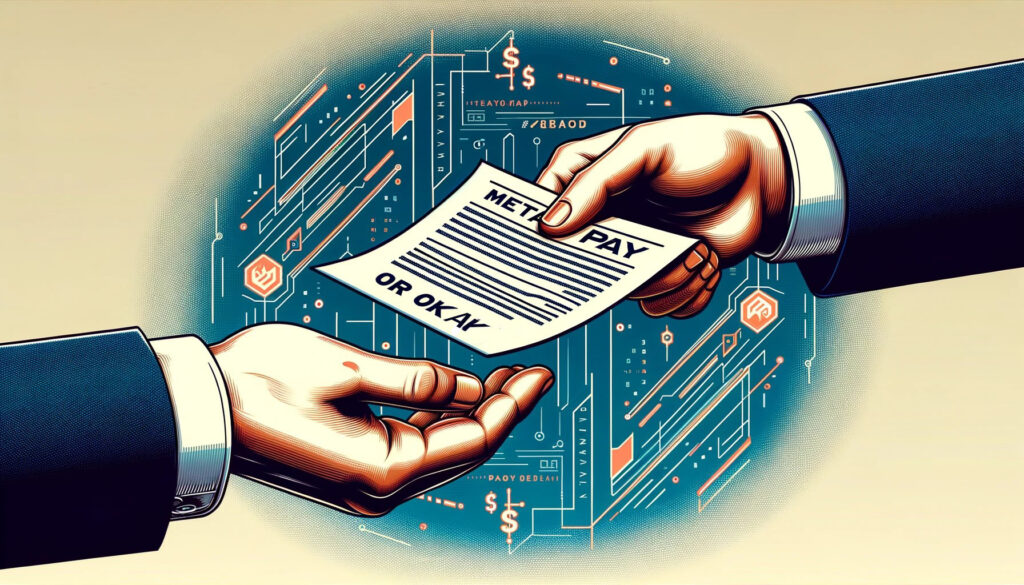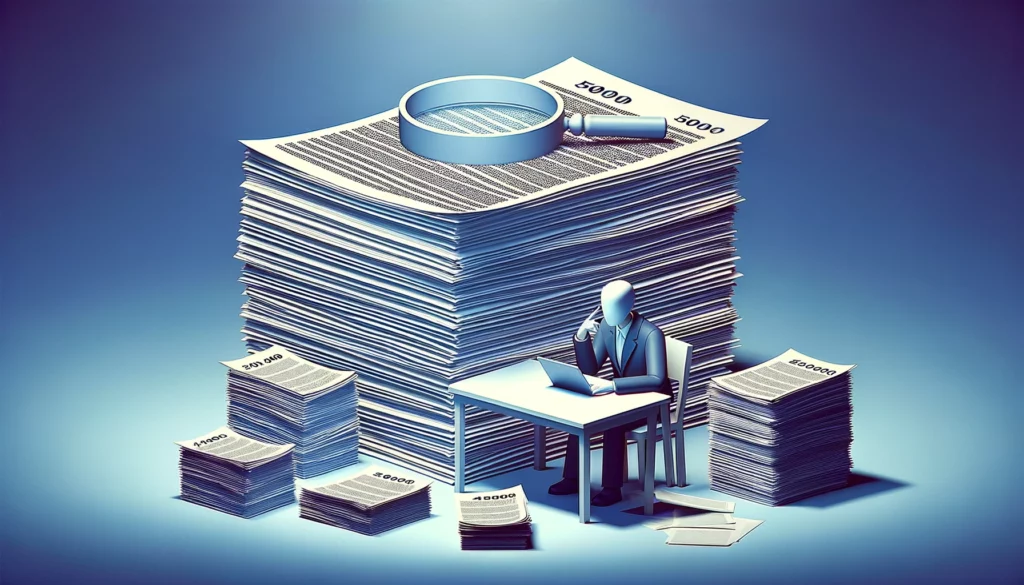13. März 2024

Wenn personenbezogene Daten digital weitergegeben werden, liegt in der Regel eine Datenverarbeitung nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vor. Obwohl dies in einer zunehmend digitalisierten Welt, immer öfter der Standard ist, übermitteln Verantwortliche manchmal Daten auch mündlich. Inwiefern eine mündliche Übermittlung als Datenverarbeitung zu werten ist, hat der EuGH in einem aktuellen Urteil vom 07.02.2024 entschieden. (mehr …)
12. März 2024
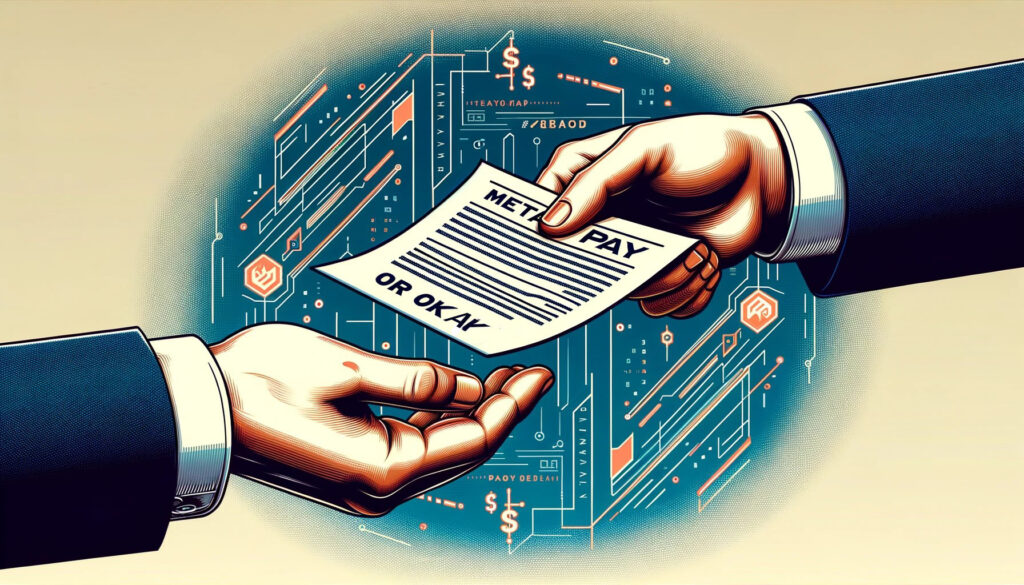
Die EU-Kommission hat am 01.03.2023 Meta zur Bereitstellung weiterer Informationen nach dem Digital Services Act (DSA) aufgefordert. Dabei geht es unteranderem um das seit Einführung stark umstrittene Bezahl-Modell für eine werbefreie Nutzung von Facebook und Instagram. (mehr …)
11. März 2024

Cookie-Banner und das damit verbundene Tracking sind nicht nur nervig, sondern beachten auch regelmäßig nicht sämtliche Datenschutzvorschriften. So hat erst letzten Monat das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) in einer anlasslosen Untersuchung die deutliche Mehrheit der geprüften Cookie-Banner als rechtswidrig eingestuft. In einer Entscheidung vom 07.03.2024 hat nun der EuGH Klarheit zu Tracking und personalisierter Werbung geschaffen. Er befasst sich unteranderem mit dem Begriff von personenbezogenen Daten und dem gemeinsamen Verantwortlichen. Das Urteil betrifft insbesondere das Real Time Bidding (RTB) und die Rolle von IAB Europe beim Ausspielen von personalisierter Werbung. (mehr …)
8. März 2024

Das EU-Parlament hat am 27.02.2024 neue Regeln zur Transparenz bei politischer Werbung mit einer Mehrheit von 470 Stimmen verabschiedet. Das Gesetz zielt darauf ab, Wahlkampagnen transparenter zu gestalten und widerstandsfähiger gegenüber Manipulation zu machen. Diese Maßnahmen sind ein bedeutender Schritt in Richtung demokratischer Integrität und informierter Wählerentscheidungen. Zudem fördern sie die Meinungsfreiheit und den Datenschutz. (mehr …)
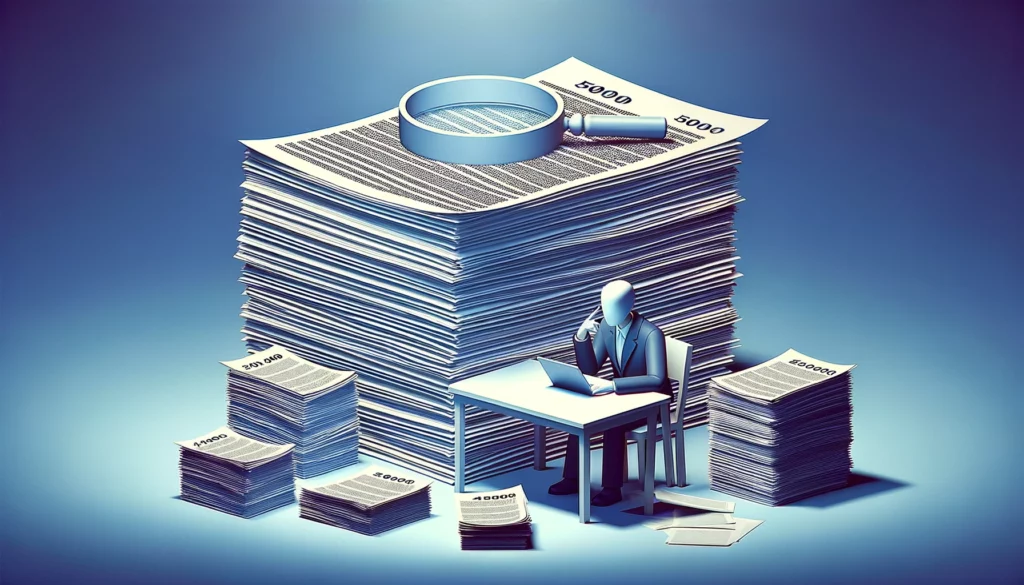
Das Auskunftsrecht ist essenzieller Bestandteil der Gewährleistung von Datenschutz. Dabei ist der Umfang dieses Auskunftsrecht bislang nicht abschließend geklärt. Immer wieder kommt es vor, dass Betroffene Auskunft über ihre gespeicherten Daten verlangen und Unternehmen diese aufgrund von Unverhältnismäßigkeit verweigern. Am 06.02.2024 hat das VG Berlin das Verlangen einer Auskunft trotz vorheriger erforderlicher Kontrolle von über 5000 Seiten gewährt. (mehr …)
6. März 2024

Mit der Verordnung für Künstliche Intelligenz (KI-Verordnung) steht die EU kurz davor, wegweisende Regelungen für den Umgang mit KI-Anwendungen zu etablieren. Hierzu hat am 28.02.2024 der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) eine Pressemitteilung zum Thema KI-Verordnung und Datenschutz veröffentlich. Darin weist er auf die Bedeutung des Datenschutzes auch im Kontext von KI hin. (mehr …)

Das Auskunftsrecht ist ein wesentlicher Bestandteil des Datenschutzes und ermöglicht es Einzelpersonen, die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu überprüfen. Deswegen hat der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) am 28.02.2024 den Coordinated Enforcement Framework (CEF) 2024 zum Auskunftsrecht gestartet. An dieser europaweiten Aktion beteiligen sich auch verschiedene deutsche Datenschutzaufsichtsbehörden. (mehr …)
4. März 2024
 Die Erfassung und Weitergabe von Fluggastdaten in der EU ist von erheblicher Bedeutung für die Sicherheit von Europa. Am 01.03.2024 haben Unterhändler des EU-Parlaments und der EU-Staaten eine Einigung über die Speicherung und Nutzung von Fluggastdaten getroffen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, terroristische Bedrohungen und schwere Kriminalität effektiver zu bekämpfen. In Zukunft müssen deshalb Fluggesellschaften bestimmte Fluggastinformationen mit den nationalen Behörden teilen. (mehr …)
Die Erfassung und Weitergabe von Fluggastdaten in der EU ist von erheblicher Bedeutung für die Sicherheit von Europa. Am 01.03.2024 haben Unterhändler des EU-Parlaments und der EU-Staaten eine Einigung über die Speicherung und Nutzung von Fluggastdaten getroffen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, terroristische Bedrohungen und schwere Kriminalität effektiver zu bekämpfen. In Zukunft müssen deshalb Fluggesellschaften bestimmte Fluggastinformationen mit den nationalen Behörden teilen. (mehr …)
1. März 2024

Die Organisationen European Digital Rights (EDRi), Global Witness, Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) und Bits of Freedom haben am 26.02.2024 eine Beschwerde gegen LinkedIn bei der EU-Kommission eingereicht. Dabei geht es um den Verdacht, dass LinkedIn sensible personenbezogene Daten, darunter Informationen zur Sexualität und politischen Meinung, für gezielte Werbung verwendet. Dies könnte einen verstoß gegen den neuen Digital Services Act (DSA) darstellen. (mehr …)
29. Februar 2024

Am 23.02.2024 hat in Bonn eine Medizindaten-Tagung des neuen Zentrums für Medizinische Datennutzbarkeit und Translation (ZMDT) stattgefunden. Die Nutzung von Gesundheitsdaten zur Erforschung von Krankheiten und zur Verbesserung von Therapien ist von enormer Bedeutung. Doch gleichzeitig birgt sie auch Risiken im Bereich des Datenschutzes. Zu diesem Thema haben sich auf der Veranstaltung verschiedene Experten geäußert. (mehr …)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 275 276