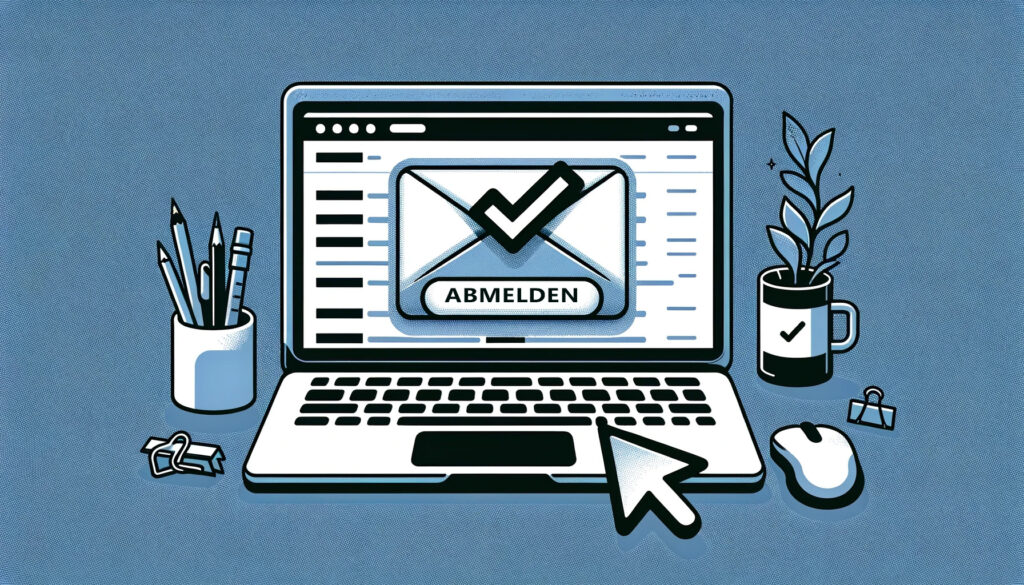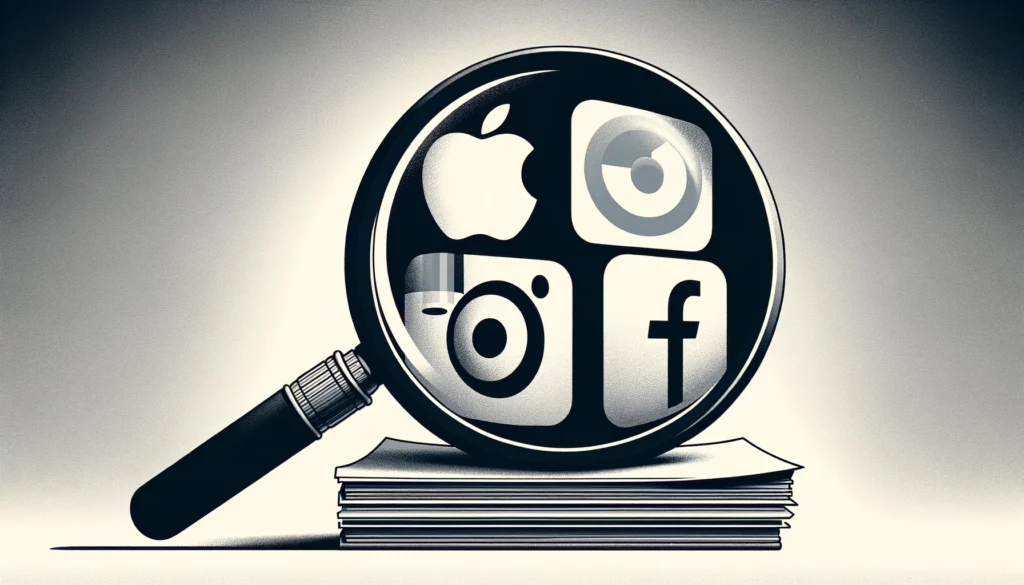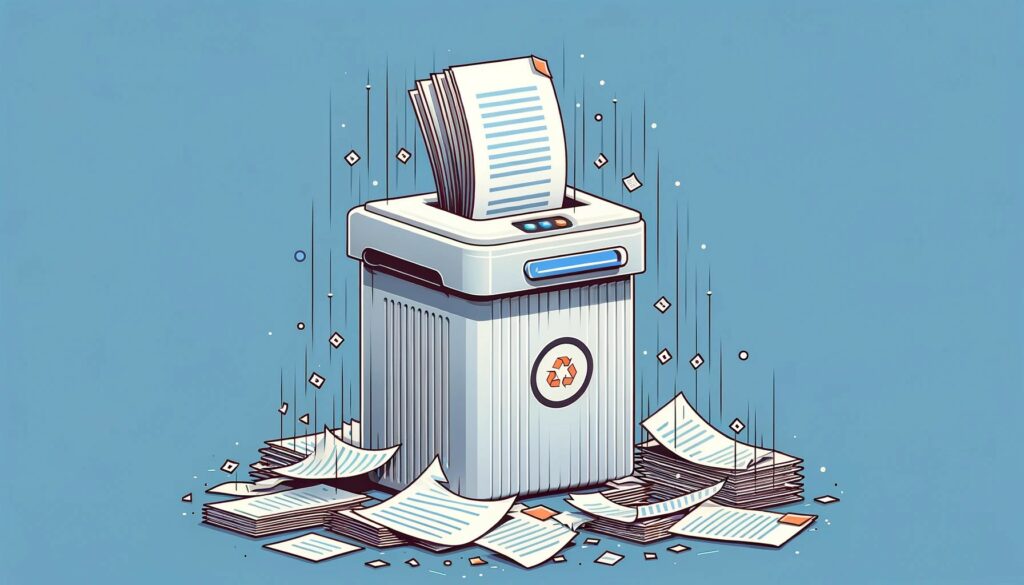Kategorie: DSGVO
23. April 2024
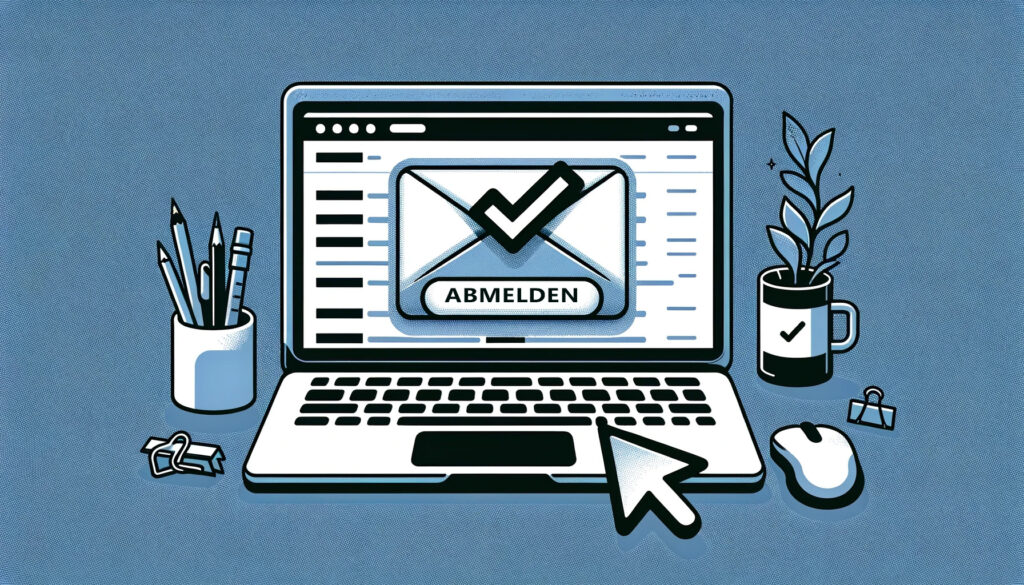
LG Paderborn: Widerspruch ist formlos sofort gültig
Ein Urteil vom 12.03.2024 hat die Rechte von Betroffenen gegen unerwünschte E-Mail-Werbung gestärkt. Das Landgericht (LG) Paderborn stellte klar, dass im Bereich des Direktmarketings der Widerspruch gegen Werbemails formlos und sofort gültig ist. (mehr …)
22. April 2024

Meta und auch immer mehr andere Unternehmen verlangen für die werbefreie Nutzung ihrer Online-Dienste eine Gebühr. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat nun auf seiner Plenartagung am 17.04.2024 eine Stellungnahme zu den sogenannten „Pay or Okay“-Modellen verabschiedet. Darin stellt er fest, dass Verbraucher weiterhin eine echte Wahlmöglichkeit haben müssen. (mehr …)
19. April 2024

Das EU-Parlament hat am 10.04.2024 bekannt gegeben, dass sich seine Mitglieder auf eine Position zu neuen Verfahrensregeln zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geeinigt haben. Das EU-Parlament entscheidet sich somit für neue Regeln zur Stärkung der Durchsetzung des Datenschutzes. Insbesondere streben sie verbesserte Betroffenenrechte und eine Harmonisierung an. (mehr …)
17. April 2024

Mit Urteil vom 11.04.2024 befasste sich der EuGH erneut mit den Anforderungen an einen Anspruch auf immateriellen Schadensersatz nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). In diesem Zusammenhang sollte der EuGH entscheiden, ob ein immaterieller Schaden durch die wiederholte und ungefragte Zusendung von Werbung von juris entstanden sei. Im Ergebnis blieb er – konsistent zu seiner bisherigen Rechtsprechung – vage. (mehr …)
16. April 2024

Laut den Schlussanträgen von EuGH-Generalanwalt Pikamäe vom 11.04.2024 trifft die Datenschutzbehörde eine Handlungspflicht, wenn sie in Folge der Prüfung einer Beschwerde eine Verletzung von DSGVO-Vorschriften feststellt. Hierbei kommt ihr allerdings ein Ermessensspielraum zu. (mehr …)
5. April 2024

In einem Beschluss vom 02.02.2024 hat sich das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart mit der rechtlichen Situation bezüglich postalischer Werbung ohne vorherige Einwilligung und ohne bestehende Kundenbeziehung auseinandergesetzt. Diese Entscheidung wirft Licht auf die Rechte von Unternehmen, Marketingaktivitäten über traditionelle Postsendungen durchzuführen. Im Übrigen wirft sie auch die Frage auf, inwiefern postalische Werbung noch zeitgemäß ist. (mehr …)
28. März 2024
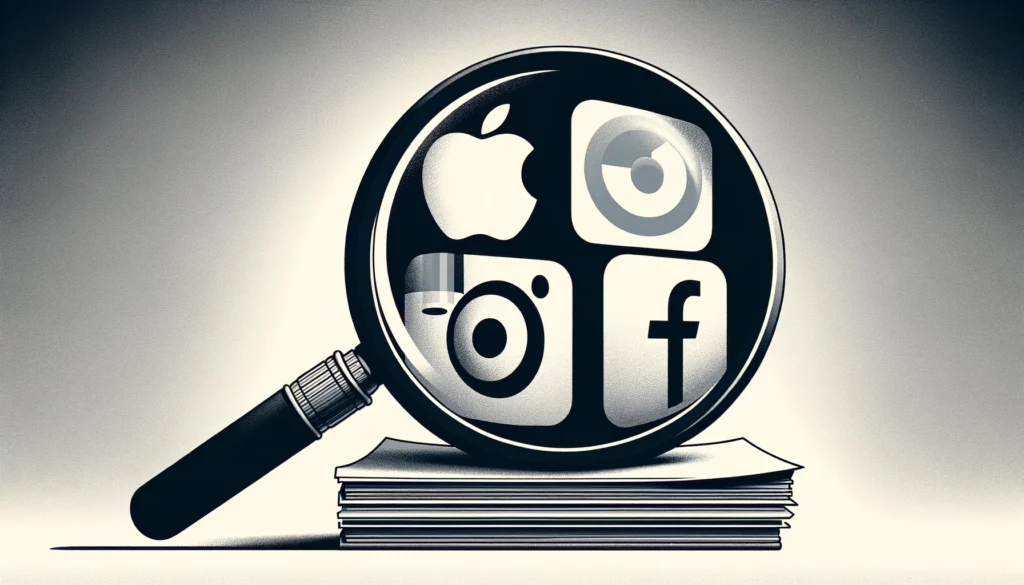
Der erst seit Anfang März gültige Digital Markets Act (DMA) schreibt verschiedene Regeln für sogenannte “Torwächter” vor. Noch vor Ende des ersten Monats hat die Europäische Kommission am 25.03.2024 ein Verfahren nach dem DMA gegen Meta, Apple und Alphabet eingeleitet. Es geht hierbei um mögliche Verstöße durch Google Play, den Apple App Store, Safari und Metas “pay or okay”-Model. (mehr …)
22. März 2024

Momentan wird im Rahmen der Neuauflage des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) über die Abschaffung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten diskutiert. Der Innenausschuss des Bundesrats hat am 11.03.2023 die Streichung der Pflicht zur Bestellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter vorgeschlagen. Der Vorschlag stößt jedoch auf Kritik. (mehr …)
21. März 2024
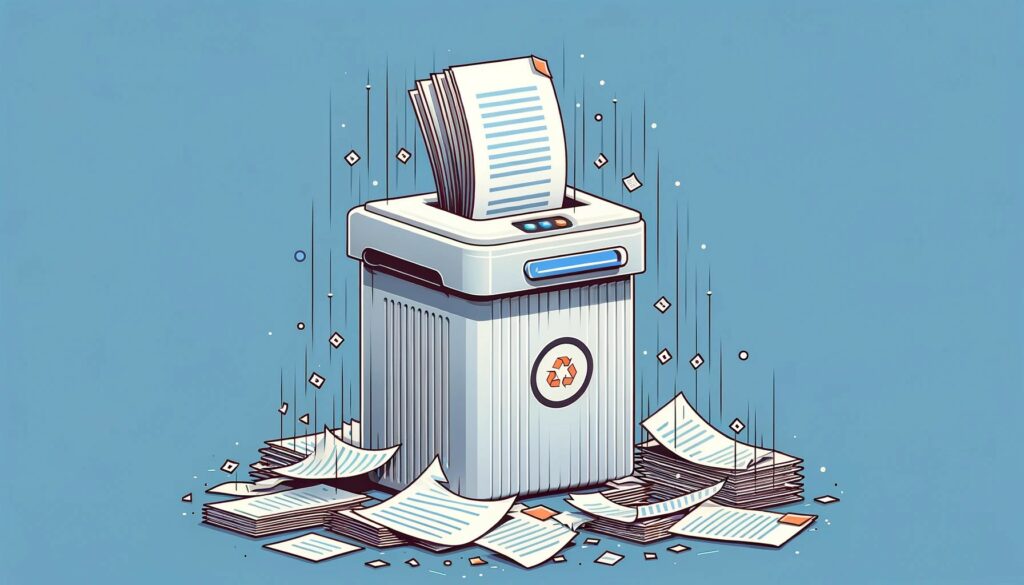
Der Schutz personenbezogener Daten ist ein grundlegendes Anliegen in der digitalen Ära. Das gilt umso mehr, wenn es um sensible Daten im Zusammenhang mit Covid-19 geht. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 14.03.2024 hat die Befugnisse einer Aufsichtsbehörde zur Anordnung der Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten Daten erweitert. Das soll auch der Fall sein, wenn die betroffene Person selbst keinen Antrag hierfür gestellt hat. (mehr …)
14. März 2024

Im Urteil des EuGH vom 05.03.2024 ging es um die gesamtschuldnerische Haftung von Europol und einem Mitgliedstaat. Konkret sollen beide in Zusammenarbeit eine rechtswidrige Verarbeitung von personenbezogenen Daten vorgenommen haben. (mehr …)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 40