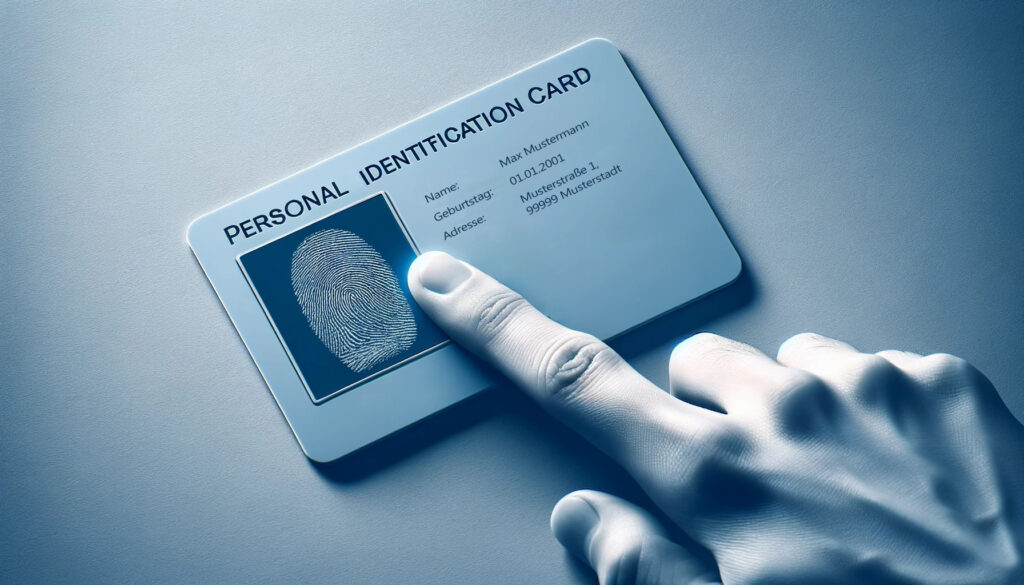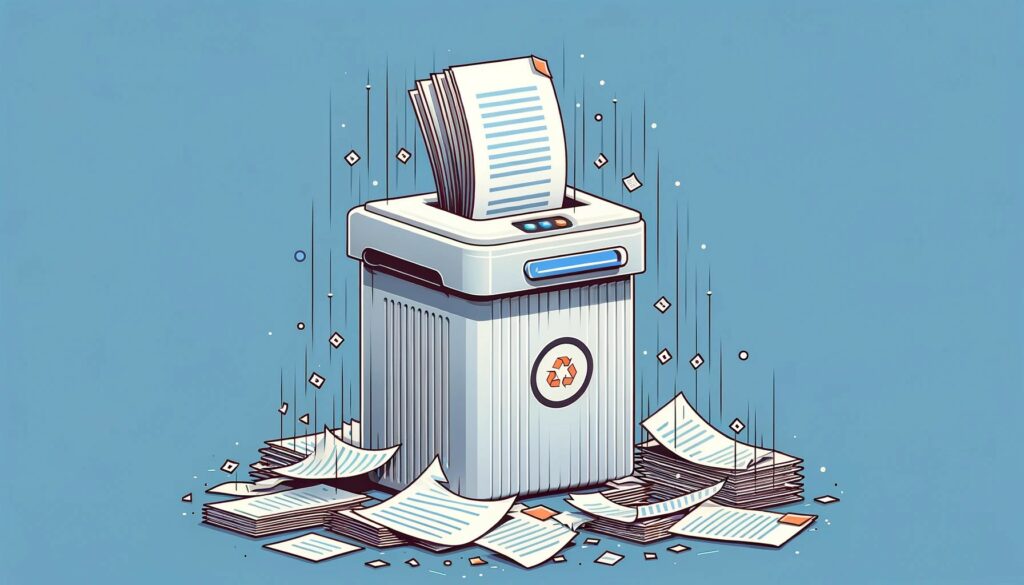Kategorie: EuGH-Urteil
17. April 2024

Mit Urteil vom 11.04.2024 befasste sich der EuGH erneut mit den Anforderungen an einen Anspruch auf immateriellen Schadensersatz nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). In diesem Zusammenhang sollte der EuGH entscheiden, ob ein immaterieller Schaden durch die wiederholte und ungefragte Zusendung von Werbung von juris entstanden sei. Im Ergebnis blieb er – konsistent zu seiner bisherigen Rechtsprechung – vage. (mehr …)
26. März 2024
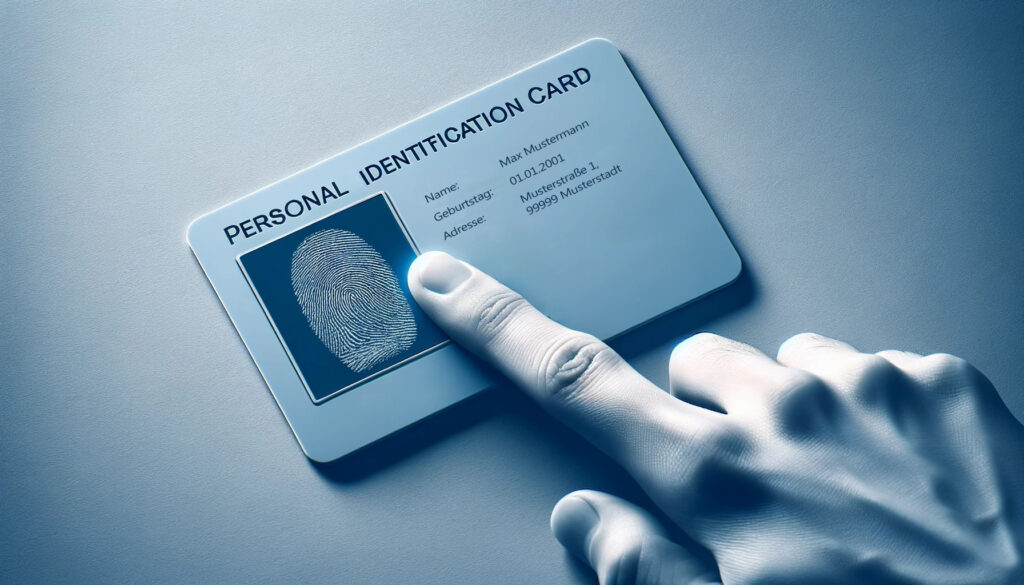
Die Aufnahme von biometrischen Daten ist in Bezug auf Datenschutzrecht ein sensibles Thema. Erst kürzlich hat der EuGH entschieden, dass eine lebenslange Speicherung dieser Informationen nicht ohne weiteres zulässig ist. In einem Urteil vom 21.03.2024 stellte der EuGH nun jedoch fest, dass zumindest die Fingerabdruckpflicht für den Personalausweis rechtmäßig ist und damit mit den Grundrechten auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz personenbezogener Daten vereinbar ist. Jedoch sei die hierfür herangezogene Rechtsgrundlage ungültig. (mehr …)
21. März 2024
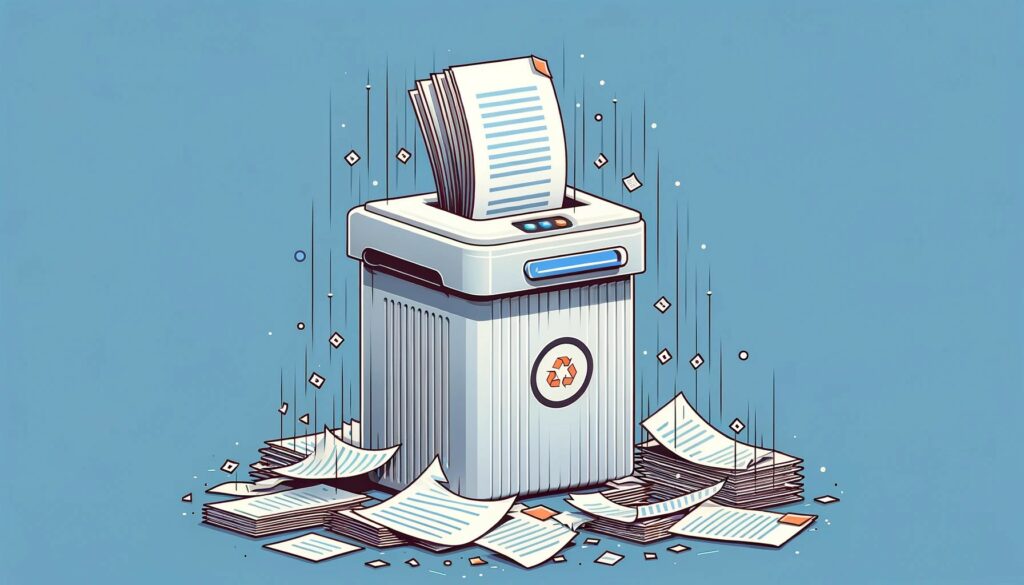
Der Schutz personenbezogener Daten ist ein grundlegendes Anliegen in der digitalen Ära. Das gilt umso mehr, wenn es um sensible Daten im Zusammenhang mit Covid-19 geht. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 14.03.2024 hat die Befugnisse einer Aufsichtsbehörde zur Anordnung der Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten Daten erweitert. Das soll auch der Fall sein, wenn die betroffene Person selbst keinen Antrag hierfür gestellt hat. (mehr …)
14. März 2024

Im Urteil des EuGH vom 05.03.2024 ging es um die gesamtschuldnerische Haftung von Europol und einem Mitgliedstaat. Konkret sollen beide in Zusammenarbeit eine rechtswidrige Verarbeitung von personenbezogenen Daten vorgenommen haben. (mehr …)
13. März 2024

Wenn personenbezogene Daten digital weitergegeben werden, liegt in der Regel eine Datenverarbeitung nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vor. Obwohl dies in einer zunehmend digitalisierten Welt, immer öfter der Standard ist, übermitteln Verantwortliche manchmal Daten auch mündlich. Inwiefern eine mündliche Übermittlung als Datenverarbeitung zu werten ist, hat der EuGH in einem aktuellen Urteil vom 07.02.2024 entschieden. (mehr …)
11. März 2024

Cookie-Banner und das damit verbundene Tracking sind nicht nur nervig, sondern beachten auch regelmäßig nicht sämtliche Datenschutzvorschriften. So hat erst letzten Monat das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) in einer anlasslosen Untersuchung die deutliche Mehrheit der geprüften Cookie-Banner als rechtswidrig eingestuft. In einer Entscheidung vom 07.03.2024 hat nun der EuGH Klarheit zu Tracking und personalisierter Werbung geschaffen. Er befasst sich unteranderem mit dem Begriff von personenbezogenen Daten und dem gemeinsamen Verantwortlichen. Das Urteil betrifft insbesondere das Real Time Bidding (RTB) und die Rolle von IAB Europe beim Ausspielen von personalisierter Werbung. (mehr …)
27. Februar 2024

Im Rahmen eines Rechtsstreits in Polen steht die Frage im Raum, ob der Verkauf einer Datenbank im Zwangsvollstreckungsverfahren zulässig ist, obwohl die Personen, deren personenbezogenen Daten betroffen sind, keine Zustimmung gegeben haben. Nach den Schlussanträgen von Generalanwalt Priit Pikamäe vom 22.02.2024 soll dies unter gewissen Voraussetzungen möglich sein. (mehr …)
8. Februar 2024
 Die Speicherung und Aufbewahrung sensibler Daten ist grundsätzlich ein schwieriges Thema. Nun hat sich der EuGH mit Urteil vom 30.01.2024 über die lebenslange Speicherung von biometrischen Daten von Verurteilten Straftätern geäußert. Nach seiner Ansicht ist eine allgemeine und unterschiedslose Aufbewahrung solcher biometrischen und genetischen Informationen bis zum Tod europarechtswidrig. (mehr …)
Die Speicherung und Aufbewahrung sensibler Daten ist grundsätzlich ein schwieriges Thema. Nun hat sich der EuGH mit Urteil vom 30.01.2024 über die lebenslange Speicherung von biometrischen Daten von Verurteilten Straftätern geäußert. Nach seiner Ansicht ist eine allgemeine und unterschiedslose Aufbewahrung solcher biometrischen und genetischen Informationen bis zum Tod europarechtswidrig. (mehr …)
30. Januar 2024
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verschärft die Anforderungen an immaterielle Schadensersatzansprüche bei Datenschutzverstößen weiter. Im vorliegenden Fall erklärt er mit Urteil vom 25.01.2024 (C-687/21), dass für einen Schadensersatz allein ein ungutes Gefühl nicht reicht. Insofern begründet eine nur kurze Datenweitergabe nach Ansicht des EuGH keinen Schaden. (mehr …)
22. Januar 2024
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) legt klare Richtlinien für die Verarbeitung personenbezogener Daten fest. Doch wie steht es um die Einhaltung der Regeln durch einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss? Besonders relevant wird diese Frage, wenn die nationale Sicherheit im Spiel ist. Ob ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss bei der Veröffentlichung eines Polizistennamen die DSGVO hätte beachten müssen, hat am 16.01.2024 der Gerichtshof der Europäischen Union in einem Fall aus Österreich entschieden. (mehr …)