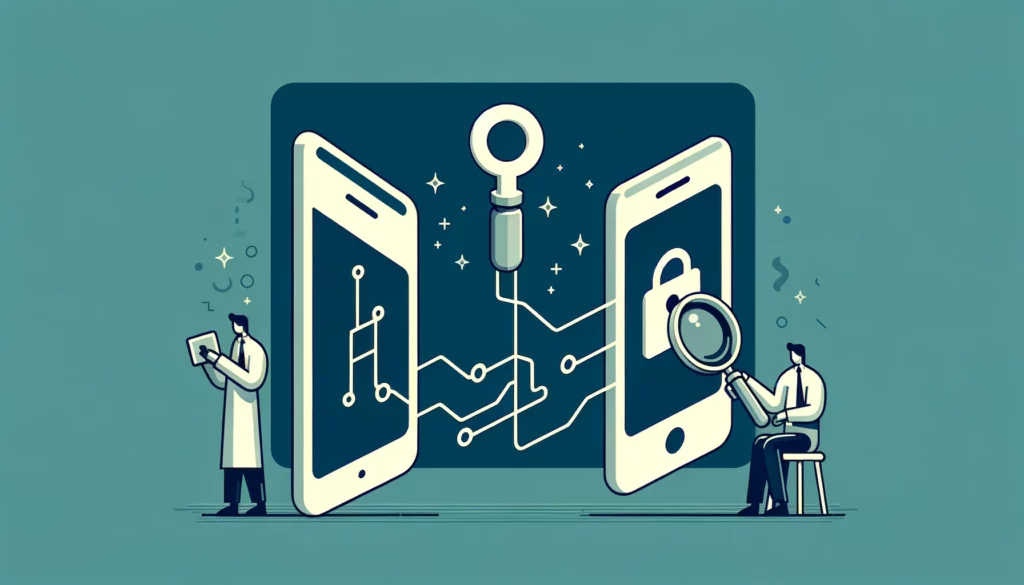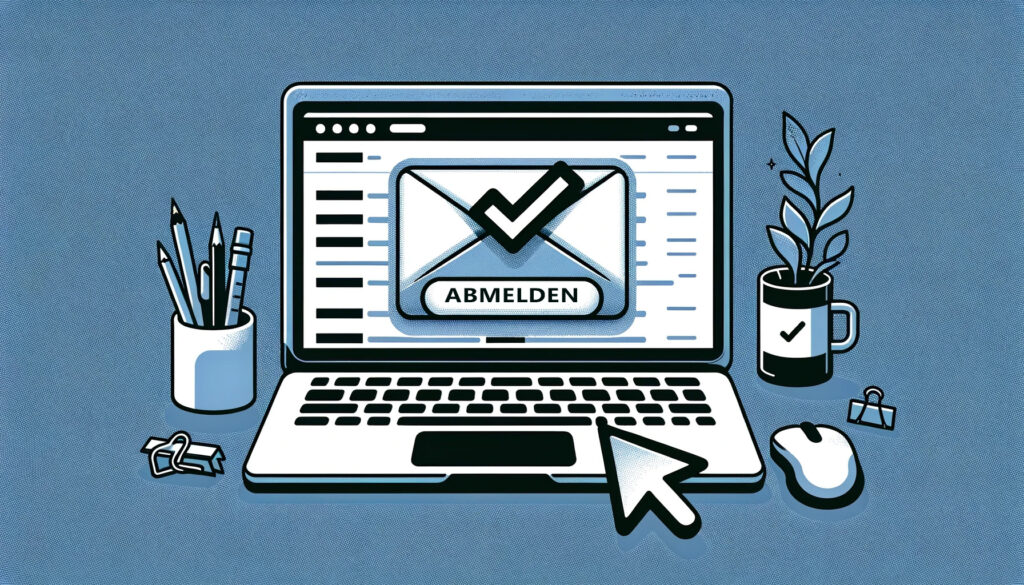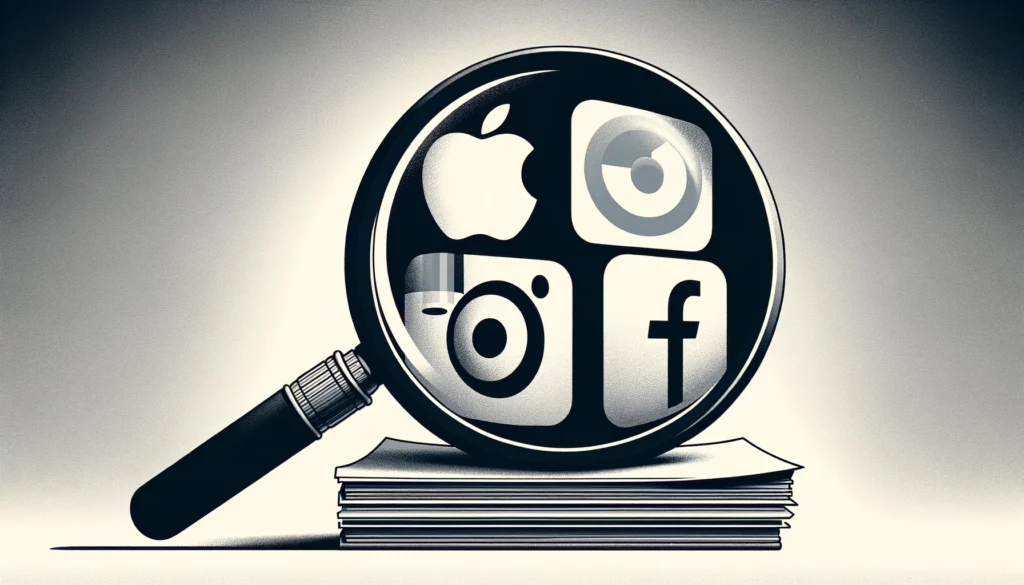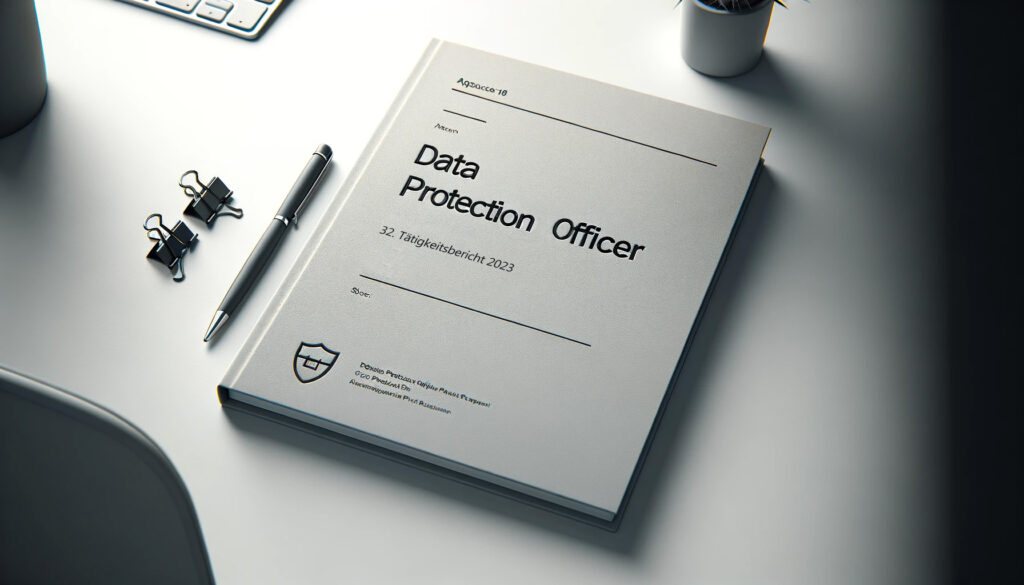Kategorie: Europäisches Recht
26. April 2024

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat am 18.04.2024 bekannt gegeben, dass er eine Strategie für den Zeitraum von 2024-2027 festgelegt hat. Mit den neuen Prioritäten reagiert der EDSA auf die sich stetig wandelnde digitale Landschaft. (mehr …)
25. April 2024

Mitglieder des EU-Parlaments haben am 18.04.2024 einen Vorschlag für ein harmonisiertes Rahmenwerk zur Sicherung und Nutzung von Finanzdaten auf EU-Ebene vorgeschlagen. Diese Initiative soll mehr Kundenkontrolle über die eigenen Finanzdaten ermöglichen. Somit handelt es sich um die Realisierung des Grundgedankens von Open Finance. (mehr …)
24. April 2024
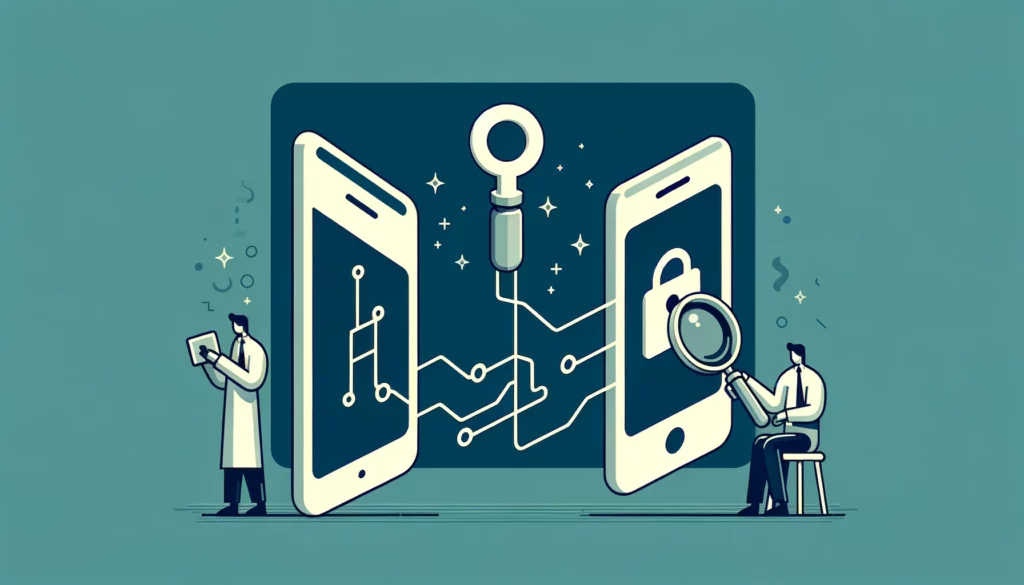
Nach einem am 17.04.2024 geleaktem Gesetzesentwurf sollen gerade die Chat-Dienste, die einen besonderen Schutz der personenbezogenen Daten ihrer Nutzer gewährleisten, ein hohes Risiko darstellen. Das bedeutet, dass die belgische Ratspräsidentschaft mit ihren jüngsten Vorschlägen fordert, dass für die Kontrolle prioritär verschlüsselte Messenger-Dienste wie WhatsApp und Signal relevant sind. Insofern stellt die geplante Chatkontrolle eine besondere Gefährdung verschlüsselter Nachrichten dar. Dass die hochumstrittene Aufdeckungsanordnung gerade bei Diensten anwendbar sein soll, die den Schutz personenbezogener Daten besonders ernst nehmen, scheint fragwürdig. (mehr …)
23. April 2024
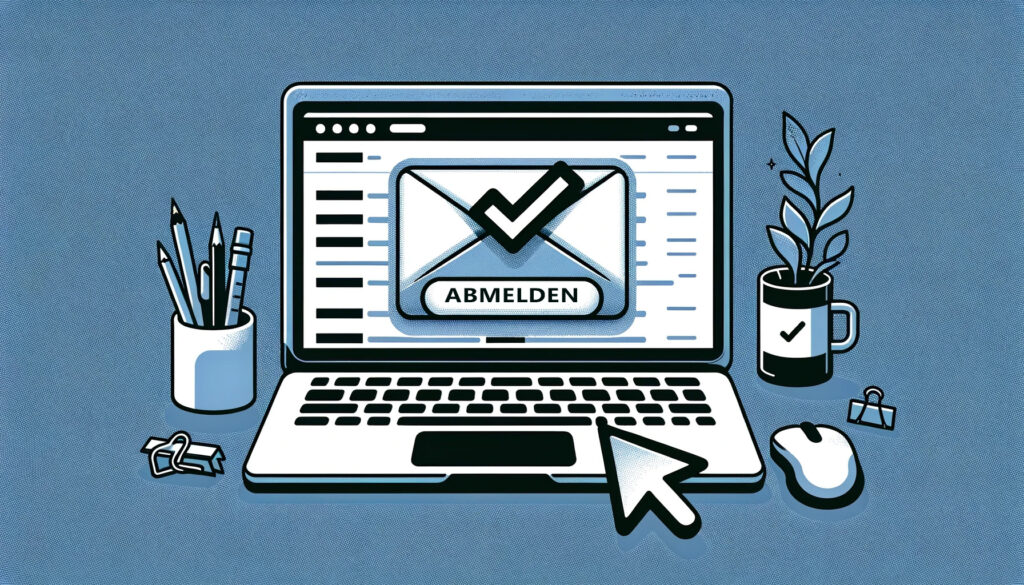
LG Paderborn: Widerspruch ist formlos sofort gültig
Ein Urteil vom 12.03.2024 hat die Rechte von Betroffenen gegen unerwünschte E-Mail-Werbung gestärkt. Das Landgericht (LG) Paderborn stellte klar, dass im Bereich des Direktmarketings der Widerspruch gegen Werbemails formlos und sofort gültig ist. (mehr …)
19. April 2024

Das EU-Parlament hat am 10.04.2024 bekannt gegeben, dass sich seine Mitglieder auf eine Position zu neuen Verfahrensregeln zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geeinigt haben. Das EU-Parlament entscheidet sich somit für neue Regeln zur Stärkung der Durchsetzung des Datenschutzes. Insbesondere streben sie verbesserte Betroffenenrechte und eine Harmonisierung an. (mehr …)
16. April 2024

Laut den Schlussanträgen von EuGH-Generalanwalt Pikamäe vom 11.04.2024 trifft die Datenschutzbehörde eine Handlungspflicht, wenn sie in Folge der Prüfung einer Beschwerde eine Verletzung von DSGVO-Vorschriften feststellt. Hierbei kommt ihr allerdings ein Ermessensspielraum zu. (mehr …)
15. April 2024

Vom 02.04.2024 bis zum 04.04.2024 hat in Washington die globale Datenschutzkonferenz (Global Privacy Summit (GPS)) organisiert von der „International Association of Privacy Professionals“ (IAPP) mit fast 5000 Teilnehmern stattgefunden. Bei den Diskussionen standen die Herausforderungen des internationalen Datenverkehrs sowie die Regulierung künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt. (mehr …)
8. April 2024

In den letzten Monaten sorgte ein Entwurf der EU-Kommission zur geplanten Chatkontrolle zur Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch wiederholt für Kritik. Die belgische Ratspräsidentschaft treibt den Vorschlag jedoch weiter voran. Trotz früherer Rückschläge könne man eine Einigung nach dem aktuellen Entwurf vom 13.03.2024 noch vor den bevorstehenden Europawahlen erreichen. Ein internes Protokoll vom 26.03.2024 zeigt hingegen, dass sich die Mitgliedstaaten weiterhin uneinig sind und die Chatkontrolle damit auch weiter ungewiss ist. (mehr …)
28. März 2024
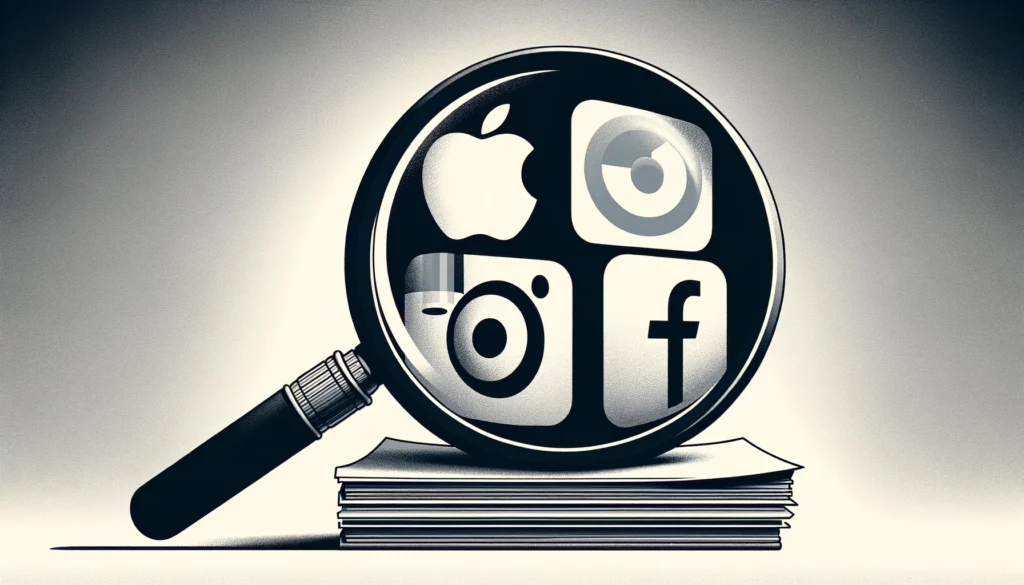
Der erst seit Anfang März gültige Digital Markets Act (DMA) schreibt verschiedene Regeln für sogenannte “Torwächter” vor. Noch vor Ende des ersten Monats hat die Europäische Kommission am 25.03.2024 ein Verfahren nach dem DMA gegen Meta, Apple und Alphabet eingeleitet. Es geht hierbei um mögliche Verstöße durch Google Play, den Apple App Store, Safari und Metas “pay or okay”-Model. (mehr …)
27. März 2024
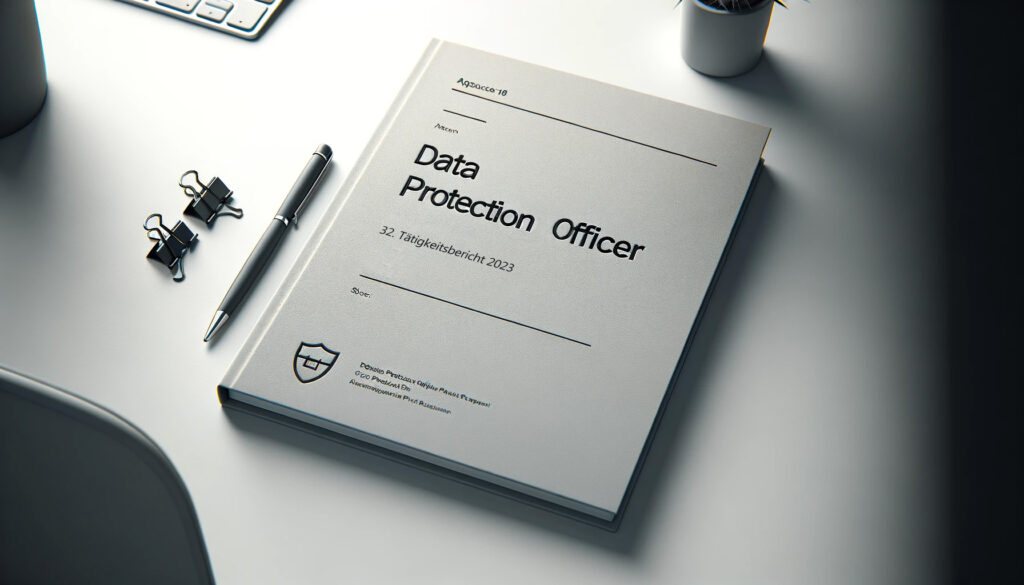
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Ulrich Kelber, hat am 20.03.2024 seinen 32. Tätigkeitsbericht übergeben. Hierin fasst er die Arbeit der Behörde im vergangenen Jahr zusammen und arbeitet wichtige Entwicklungen und Herausforderungen im Datenschutz heraus. (mehr …)